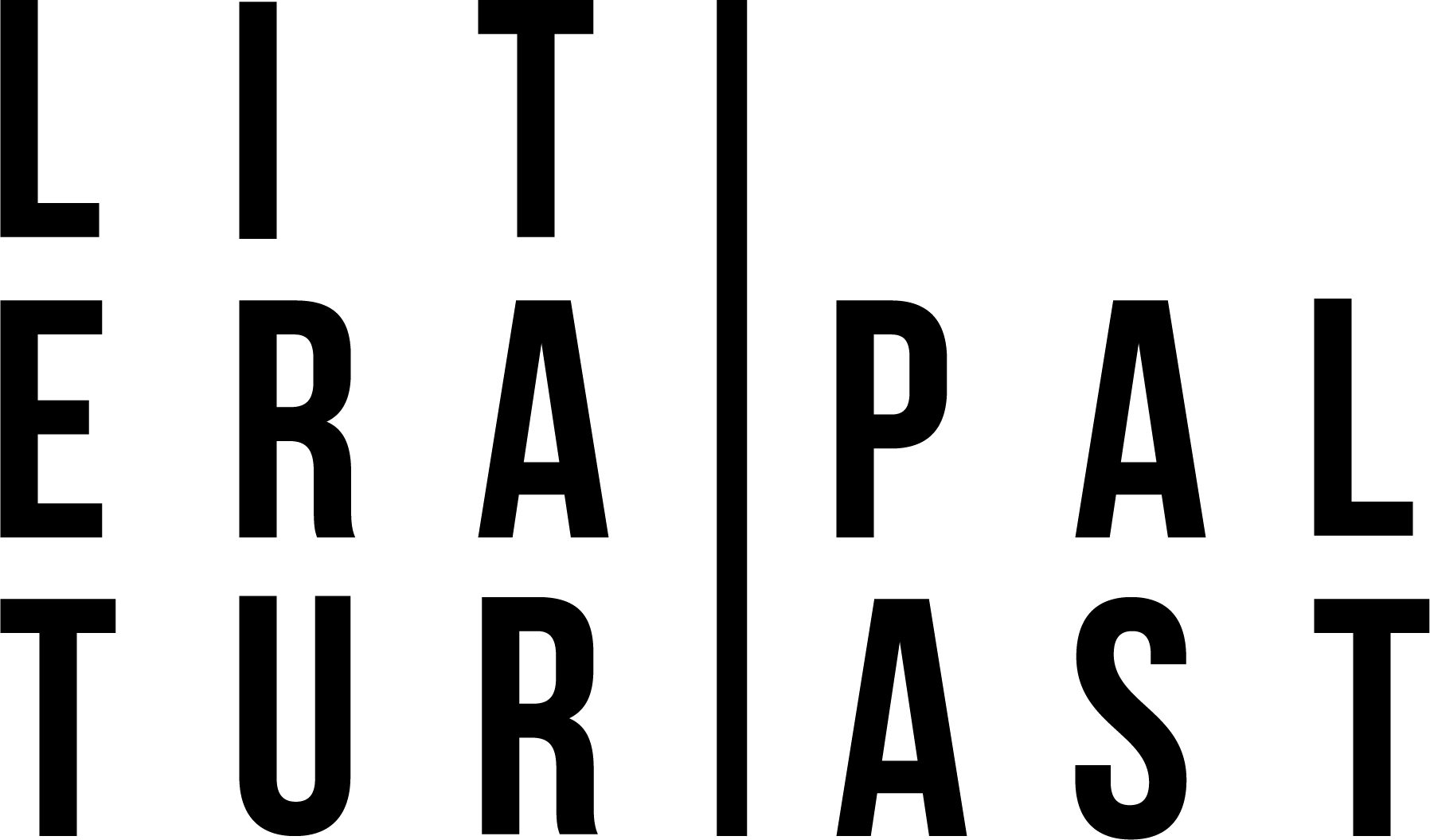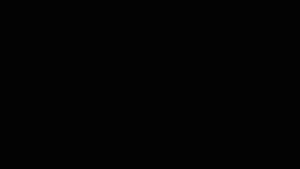Am 11. Juli 1995 nahmen die Truppen des bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladić die Stadt Srebrenica ein. In den Folgetagen wurden über 8000 muslimische Jungen und Männer getötet und in Massengräbern verscharrt, zudem unzählige bosnische Frauen vergewaltigt. Der Völkermord von Srebrenica gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und droht dennoch, vergessen zu werden …
Emir Suljagićs Srebrenica – Notizen aus der Hölle (Zsolnay Verlag, 2009), übersetzt von Katharina Wolf-Grießhaber, stellt sich gegen das Vergessen und gibt den Zahlen einen Namen und eine Geschichte. Ein bemerkenswerter Text und eine große Empfehlung, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es die beste Einführung in die Thematik ist, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat (natürlich kann ich mich irren). Denn das Buch beschäftigt sich weniger mit den historischen Hintergründen, einer lückenlosen Rekonstruktion der Ereignisse vom Juli 1995 oder den politischen und juristischen Folgen des Völkermords, sondern stellt vielmehr die persönlichen Erinnerungen und Reflexionen des Autors in den Vordergrund: Eindringlich erzählt Suljagić darin vom Leben in der belagerten Stadt Srebrenica, in die er 1992 als 17jähriger Kriegsflüchtling gekommen ist und in der er insgesamt drei Jahre verbracht hat.
Emir Suljagić beobachtet genau, stellt Verbindungen her, porträtiert zahlreiche Menschen in der Enklave ohne diese (oder sich selbst) zu idealisieren, schlägt einen ruhigen und gewissenhaften Ton an. Sein Bericht ist nicht immer frei von Pathos, gerade wenn er über moralische Probleme nachdenkt. Man mag es ihm nicht verübeln. Verhandelt er jedoch Leben und Tod – sein Vater wird schon zu Kriegsbeginn ermordet, sein Großvater und weitere Verwandte und Freunde fallen dem Massaker zum Opfer – berichtet er auffallend nüchtern, nimmt sich ganz zurück.
Insofern ist es schade, dass der Titel der deutschen Ausgabe ein wenig reißerisch daherkommt. Direkt übersetzt heißt das Buch nicht Notizen aus der Hölle, sondern Postkarten aus dem Grab. Ein assoziationsreicher Titel, der einerseits die Literarizität des Textes betont, der aus vielen kleinen, geschickt komponierten Erzählungen besteht, und andererseits auf das Thema der Kommunikation verweist, das in der Enklave von großer Bedeutung war. So geht es im Buch u. a. um die langen Schlangen vor dem Funkhaus und dem Postgebäude sowie um die Zensur von Briefen und Schriftstücken. Zudem betont der Titel des Bandes das Thema der Zeugenschaft – lange Zeit waren Suljagićs Erinnerungen der einzige Bericht eines Überlebenden des Massakers in Buchform.
Nicht zuletzt führt das Buch auch das „Grab“ im Titel und verweist damit auf die vielen Massengräber in der Region, die eine genaue Bestimmung der Opferzahlen des Massakers, aber auch des Bosnienkrieges im Allgemeinen so schwierig mach(t)en. Über die langwierige und beschwerliche Suche nach den Vermissten aus dem Bosnienkrieg habe ich mich mit der Journalistin Taina Tervonen in meinem Podcast Literaturpalast Audiospur unterhalten. Gleichzeitig wurde Srebrenica bereits lange vor dem Genozid für viele Geflüchtete zu einem Grab. Die Enklave wurde immer wieder beschossen und bombardiert, auch während der Nahrungssuche in den umliegenden Feldern und Dörfern oder während der versuchten Flucht in andere Ortschaften fanden viele Menschen den Tod.

Obwohl das Buch zwangsläufig auf das Massaker im Juli 1995 zusteuert, liegt der eigentliche Fokus auf den drei Kriegsjahren vor dem Fall Srebrenicas. Doch gerade diese Kapitel und Passagen machen das Buch so erschütternd. Suljagić berichtet von Hoffnungslosigkeit, ständiger Todesangst und dem völligen Verlust von Stabilität. Das Leben in der Stadt ist von Nahrungsarmut und Hunger geprägt, von Kriminalität, Korruption und Machtmissbrauch. Die ärztliche Versorgung ist stark eingeschränkt, Medikamente sind kaum vorhanden. Mit der Zeit bemerkt Suljagić eine Veränderung seines eigenen Charakters. Aus dem schüchternen und zurückgezogenen Jungen von einst ist ein aggressiver und roher Erwachsener geworden, der ums Überleben kämpft. In Srebrenica herrscht ein Krieg im Krieg:
”„Tagsüber kämpften wir gegen die Serben, nachts gegeneinander, um jeden Bissen Essen, um eine Plastikpackung [gemeint sind hier die Hilfsgüter, die mit Transporten in die Stadt gelangten oder aus der Luft abgeworfen wurden, T. S.]. Die Leute verloren zum wer weiß wievielten Mal alle Skrupel, überschritten alle Grenzen des Anstands und verloren noch einmal ihre Würde. Der Existenzkampf hatte eine neue Form angenommen.“
Emir SuljagićSrebrenica - Notizen aus der Hölle
Emir Suljagić hat deshalb überlebt, weil er sich während des Kriegs selbstständig Englisch beibrachte und in Srebrenica als Dolmetscher und Übersetzer für die Unmo (United Nations Military Observers) arbeitete. Diese Verbindung beschützte ihn, hindert ihn in seinem Buch aber nicht daran, hart mit den UN-Soldaten ins Gericht zu gehen. Während der Belagerung bereicherten sich diese mitunter durch den Handel mit Hilfsgütern an der Bevölkerung, vereinzelt nutzen sie zudem die Lage verarmter Frauen aus, die keine andere Wahl hatten, als ihren Körper zu verkaufen. Im Moment des Massakers erkennt er im Verhalten der Militärbeobachter „eine kalte, fast bürokratische Gleichgültigkeit, einen Verrat“.
Bis in die Gegenwart setzt sich Suljagić für die Rechte der Überlebenden des Völkermordes von Srebrenica ein. Nach dem Krieg studierte er Politikwissenschaft in Sarajevo und Bologna und promovierte am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Lange Jahre war er journalistisch tätig, arbeitete als Korrespondent für das in Sarajevo erscheinende Magazin Dani und berichtete u. a. vom Milošević-Prozess in Den Haag. Er war er Bildungsminister des Kantons Sarajevo (2011/12), kurzzeitig auch stellvertretender Verteidigungsminister Bosniens (2015). Heute leitet er die Gedenkstätte zur Erinnerung an den Völkermord von Srebrenica in Potočari.

[Das Buch von Emir Suljagić ist aktuell leider vergriffen. Es sollte aber in vielen Bibliotheken verfügbar sein.]