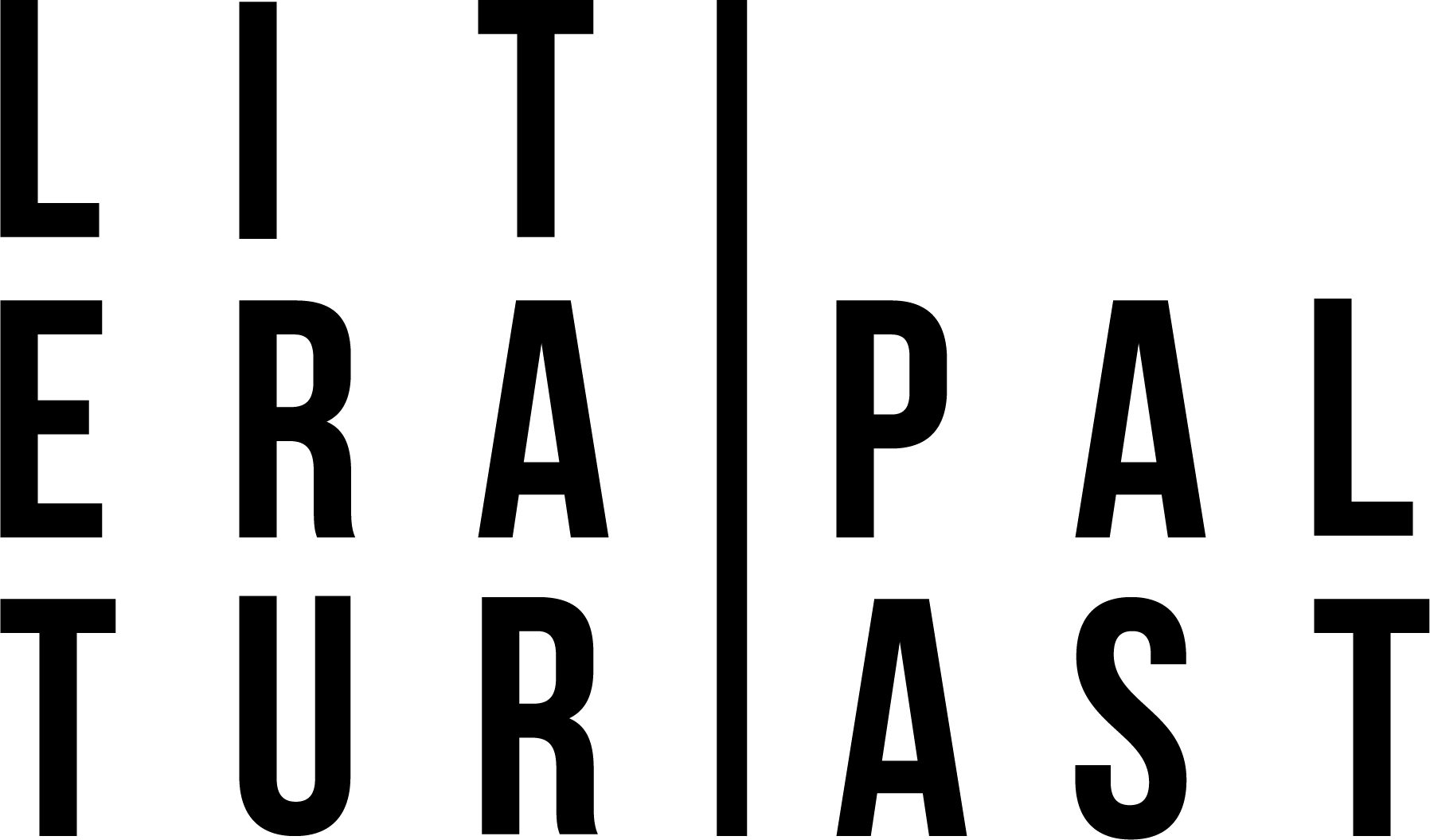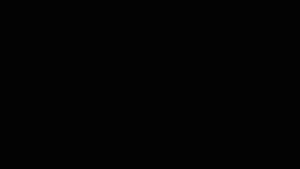Du suchst nach einem Faden, nach einer Spur, mehr noch: nach einer Stimme, denn du brauchst diese Stimme zum Schreiben, du brauchst sie unbedingt, sonst kann kein Text entstehen (du schreibst um Hilfe und womöglich, so hoffst du, besteht genau darin die Lösung). Und du möchtest, dass ein Text entsteht, ein Text, der deinen Gegenstand zumindest streift oder ihm gelegen kommt. Sie müssen sich nicht ähneln, nur verstehen (aber wer soll das beurteilen). Dein Gegenstand ist (die) Literatur, dein Text ist es nicht. Und doch bitten sie sich höflich um Verständnis.
Du schaust vom Laptop auf, blickst aus dem Fenster und bemerkst eine Nachbarin im Hof. Sie bringt ihren Müll weg und lugt dabei einen Moment zu lang in eine der Tonnen. Nun erkennt auch sie dich hinter der Fensterscheibe. Sie wirkt beschämt, winkt dir verstohlen zu und lächelt freundlich (meint es aber nicht ernst).
Nach dieser unglaubwürdigen Episode wendest du dich wieder deinem Text zu, wohl wissend, dass du dich nun auch um deinen Gegenstand kümmern solltest. Daher gaukelst du dir glaubwürdig vor, es gäbe nur einen. Und so es einen gibt (und den gibt es), heißt dieser: Dreckskerl. Eine Antibiographie. Der Debütroman von Wojciech Kuczok (vorab gab es bereits mehrere Erzählbände, auch diese sind von Gewicht) wurde in Polen bereits im Jahr 2003 veröffentlicht, gewann sämtliche Preise und wurde unter dem Titel Striemen von Magdalena Piekorz verfilmt. Die deutschsprachige Ausgabe erschien 2007 in der Übersetzung von Gabriele Leupold und Dorota Stoińska im Suhrkamp Verlag.
Beim Aufschlagen des schmalen, etwa 170 Seiten umfassenden Romans – unterteilt in ein Damals, Dann und Danach –, möchtest auch du alliterieren: den Dreckskerl derbe durch den Dachstuhl drillen. Du fragst dich kurz, ob das einen Sinn ergibt (meinst es aber nicht ernst). Dann fragst du dich, ein wenig aufrichtiger, was es mit dem Begriff der „Antibiographie“ auf sich hat, stolperst durch Google und erkennst sehr schnell, dass fast alle Wege zum Dreckskerl führen. Kuczok mag das Wort nicht erfunden haben, doch nun gehört es ihm. Was aber gehört dem Ich-Erzähler seines Buches (das du lapidar Roman genannt hast / das der Klappentext wenig überraschend Roman nennt / das sich aber gar nicht als Roman ausweist, sondern eben als Antibiographie)? Nicht viel, so scheint es, nicht viel.

Die Nachbarin ist von den Mülltonnen verschwunden. Sie muss sich beobachtet gefühlt haben, da sie beobachtet wurde. Eine dickliche Krähe hat ihren Platz eingenommen. Sie kommt ab und an zu Besuch und singt im Hof ihr Lied.
Es ist eine Biographie trotz allem, denkst du dir. Ein Leben, verunmöglicht, abgestoßen und zugerichtet, doch ein Leben, das lebt. Der Hinweis „Alle auf den Seiten dieses Buches auftretenden Personen und Begebenheiten sind fiktiv…“ führt wie immer dazu, dass du dir sicher sein kannst, es hier mir einem autobiographischen Text zu tun zu haben (dein Text ist es nicht, auch das eine leere Behauptung). Das Buch erzählt von einer Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren in Oberschlesien, der Autor wurde ebendort im Jahr 1972 geboren. Zudem wird der Vater des Ich-Erzählers als „der alte K.“ bezeichnet. Du willst darin nicht nur den alten Kuczok erkennen, sondern auch einen Verweis auf den bekanntesten K. der Literaturgeschichte: Kafka geistert durch diesen Text, Entfremdung und Entmenschlichung, eine Abrechnung mit dem Vater, mit allen Vätern.
Und so beginnt das Buch – im Teil Damals – mit dem Vater des Vaters, dem Vater des alten K. und dem Untergang der einst bürgerlichen Familie mit aristokratischer Attitüde. Der Zweite Weltkrieg kommt, das Parterre muss verkauft werden, gewöhnliche Menschen ziehen ein. Ein ganzes Gewimmel schrulliger Familienangehöriger tritt auf, scheitert, verunglückt und hinterlässt keine Spuren. Der einzige Nachkomme ist der namenlose Ich-Erzähler, Sohn des alten K., der den gesamten Groll seines Vaters auf sich zieht. Der zweite, umfangreichste Teil des Buches Dann erzählt von den Züchtigungen und Schlägen, die diese gewaltvolle, im Grunde unerträgliche Vater-Sohn-Beziehung definieren, die dann im kurzen Schlussteil Danach ins scheinbar Apokalyptische kippt: Eine Traumsequenz, die die Antibiographie in eine Wunschbiographie (du denkst an Peter Weiss) überführt.

Die plötzliche Stille irritiert dich und du schaust in den Hof. Kein Blatt des Ahornbaums wiegt sich im Wind. Die Krähe ist verschwunden. Niemand ist dort, kein Mensch, kein Tier, nichts passiert.
So viel passiert, denkst du dir. Es ist ein grausames Buch, das sich nicht an seinen Grausamkeiten berauscht; ein dichter, fein gewobener Text, der zahlreiche Themen aufgreift – strukturelle Gewalt, Misogynie und Homophobie, katholische Sexualmoral, Nationalismus und besonders prägnant: die Klassenfrage –, diese in ihrer Komplexität begreift und der wie jeder Text, der sich und seine Sujets wirklich ernst nimmt, nicht ohne Klamauk auskommt. Mehr noch als der gesellschaftspolitische Gehalt ist es aber die Sprache, die dich für diesen Dreckskerl einnehmen lässt (es ist nicht ganz klar, wer dieser Dreckskerl eigentlich ist – mehrere Personen werden so benannt). Hier sitzt jeder Satz, viele Begriffe und Formulierungen sind hervorragend gewählt und originell, ohne plump aufzutrumpfen.
Als ebenso sorgfältig empfindest du auch die Übersetzung von Gabriele Leupold und Dorota Stoińska (dein Urteil ist angreifbar, da du kein Polnisch sprichst, obwohl diese Sprache in deiner eigenen Kindheit und Jugend sehr wichtig für dich war). Du nickst kurz mit dem Kopf und fragst dich gleichzeitig, wie wohl das polnische Original mit dem Schlesischen umgegangen ist, das hier folgendermaßen klingt: „Wos ist das für a Gemäkl bei Tisch, frog ich mia, oder hot oina Würma im Orsch?“ Das tönt doch hübsch, findest du, willst weder mäkeln, noch hast du Würmer im Hintern. Und möchtest zum Ende kommen und hoffst, einen Text geschrieben zu haben, der deinen Gegenstand zumindest streift. Dein Gegenstand ist (die) Literatur, dein Text ist es nicht.
Nicht doch, ein lautes Krachen im Hof. Du stehst auf, öffnest das Fenster und siehst sofort die umgefallene Mülltonne, die erst vorhin von deiner Nachbarin inszpiziert wurde. Wer kann sie umgeworfen haben? Auf dem Boden verteilt liegen Scherben, Verpackungsmaterial und Kaffeegrund (hier wird kein Müll getrennt), zwischen all dem Abfall eine verdreckte Kopie eines bekannten Bildes von Roy Lichtenstein. Darauf setzen zwei blonde Menschen zielgerichtet zu einem Kuss an (meinen es aber nicht ernst). Das Bild hat dir noch nie gefallen.