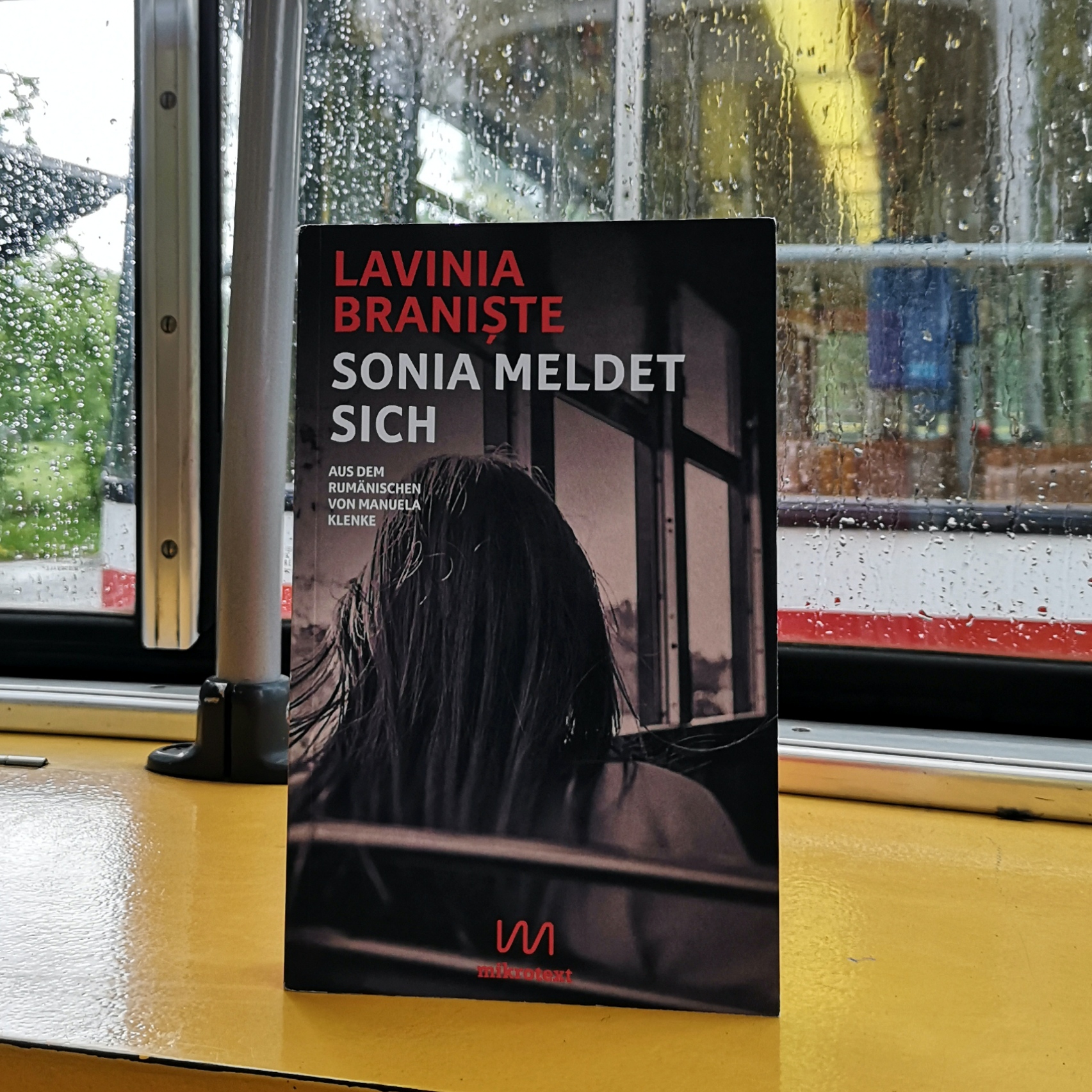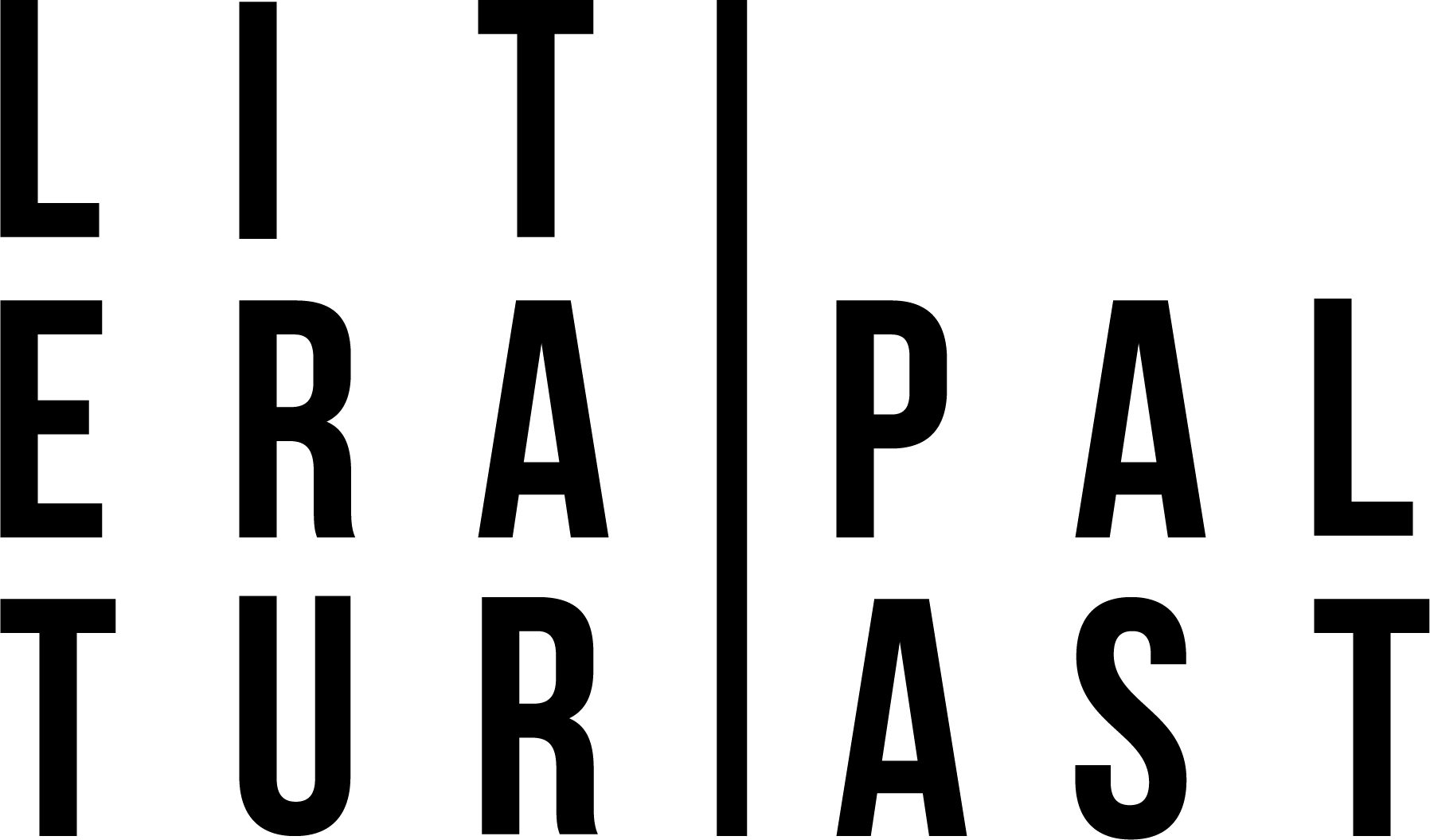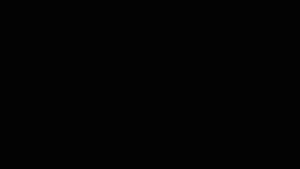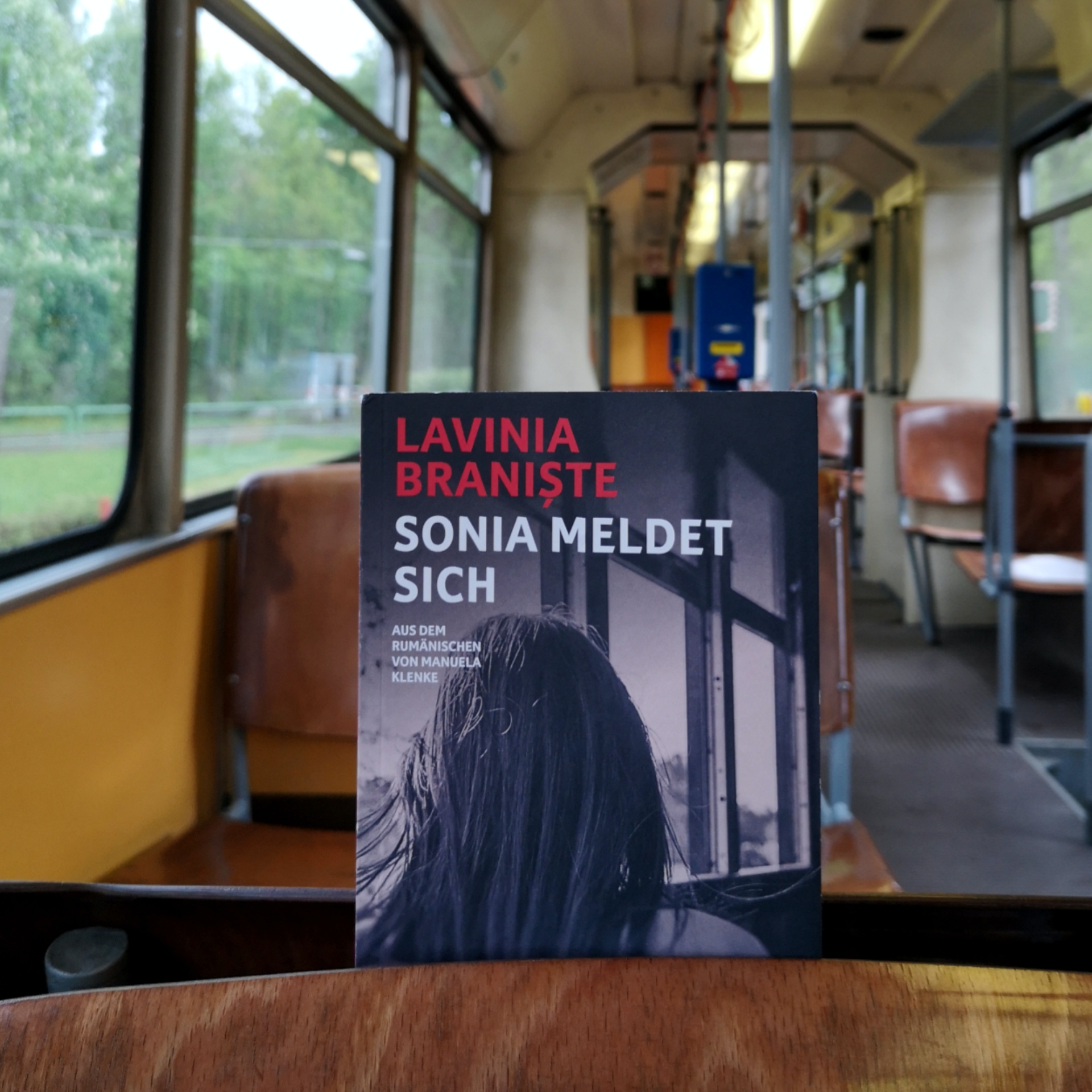
Die Straßenbahn rattert am Art Café vorbei und Paul verspätet sich. Es ist. Zumindest heute. Nicht sein Verschulden. Ein technisches Problem hat ihn aufgehalten. Ein defekter Fahrstuhl. Eingeklemmt zwischen zwei Etagen, musste er sich mit einem Schweizer Taschenmesser aus einer Situation befreien, die zu alltäglich scheint, als dass sie weiterer Fragen bedürfte. Nun zeigt er Sonia seine Hände. Sie sind voller Schrammen, Kratzer. Und Blut. Die rote Blutspur, die in der ersten Szene von Lavinia Braniştes Sonia meldet sich (Mikrotext, 2021) an die Oberfläche dringt. Wird sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise durch den gesamten Roman ziehen: Als Verbrechen des Ceaușescu-Regimes. Als Blutsverwandtschaft und gekappte Familienbande. Als Menstruationsblut, das vermeintlich progressive Beziehungsmodelle in die Schranken weist.
Die titelgebende Hauptfigur Sonia ist Ende 20 und gerade mit ihrem Freund Paul zusammengezogen. Mehr oder weniger. Aus pragmatischen Gründen. Sie arbeitet beim Radio, schreibt für einen Blog und hat noch viele weitere Online-Jobs. Um sich in Bukarest über Wasser zu halten. In ihren Blogbeiträgen beschäftigt sie sich mit Zukunftsthemen. Doch nun wird ihr ein Projekt angeboten, in dem sie sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen soll. Ein Regisseur, der durch ihre Texte auf sie aufmerksam geworden ist. Bittet Sonia darum, ein Drehbuch für ihn zu verfassen. Geplant ist ein Film über die Diktatorentochter Zoia Ceaușescu. Deren Beziehung zu ihren Eltern Nicolae und Elena. Über die Schließung eines ganzen Instituts, nur um Zoia zu schaden. Da sie sich nicht so verhält, wie es sich ihre mächtigen Eltern wünschen. Mit zu vielen Männern ausgeht. Fortan von der Securitate überwacht wird. 1974. Im kommunistischen Rumänien.

”"Was ihr Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die Vergangenheit, die sie interessiert, die nicht einmal so lange her ist, so tief begraben ist, dass sie überhaupt nicht als ein kohärentes, ganzes Etwas ausgegraben werden kann. Man kann nur Bruchstücke, sehr sehr unterschiedliche Scherben, ausgraben."
Lavinia BranişteSonia meldet sich
Sonia macht sich an die Arbeit. Nur fällt es ihr schwer, zu ihrem Gegenstand vorzudringen. Über die Zeit vor ihrer Geburt im Jahr 1989 weiß sie zu wenig. In diesem Punkt ist sie kein Einzelfall. Die Faktenlage ist uneindeutig. Die Lehrpläne voller Fragezeichen. Die Aufarbeitung der Diktatur in Rumänien: ein Erinnerungskrieg. Sonia schaut Filme, besorgt sich Forschungsliteratur, liest Autobiographisches, spricht mit Menschen und geht zu Vorträgen. Empfindet viele Stimmen und Publikationen als parteiisch und nicht vertrauenswürdig. Verschlossene Archive und verschlossene Münder. Sonia erkennt: Das Vergangene ist nicht tot. Es ist noch nicht einmal vergangen. Wovon also reden die Menschen, wenn sie von „früher“ sprechen? Auf Podien, Veranstaltungen und im persönlichen Austausch. Sonia hebt die Hand und möchte eine Frage stellen.
Sonia hebt die Hand und findet kein Gehör. Wird übertönt und ausgeklammert. Kann sich keinen Zugang verschaffen, so wie sie sich auch kein kohärentes Bild von der rumänischen Geschichte machen kann. Findet stattdessen: ein Mosaik aus Scherben. Gleiches gilt für ihre eigene Familiengeschichte, die im Roman eine immer größere Rolle einnimmt. Dem Tod ihres Vaters, den sie kaum kannte, schließt sich eine zweite Recherche an. Die Suche nach den eigenen Wurzeln. Was auch immer das ist. Letztlich auch nach den Verstrickungen ihrer Familie im Ceaușescu-Regime. Sonia meldet sich. Bei der Mutter. Bei Patentante und Großvater. Und findet kaum Gehör. Findet stattdessen: verschlossene Münder.
Lavinia Braniştes Roman, der von Manuela Klenke ins Deutsche übertragen wurde, ist kein Roman über den rumänischen Kommunismus. Vielmehr verhandelt das Buch die Unmöglichkeit, der politischen wie persönlichen Geschichte. Unweigerlich verbunden. Habhaft zu werden. Parallel dazu entwickelt Sonia meldet sich eine notwendige feministische Perspektive auf die rumänische Gegenwart und Erinnerungskultur. Aktuelle Geschlechterdiskurse und Debatten um Macht und Ohnmacht durchdringen sämtliche Aspekte der Handlung, verdeutlichen Sexismus und eingefahrene Strukturen. In Beziehungs- und Arbeitsleben, Körperbildern und Familienkonstellationen. Im Blick auf die Vergangenheit. Kontinuitäten statt Brüche. Fehler. Im System.